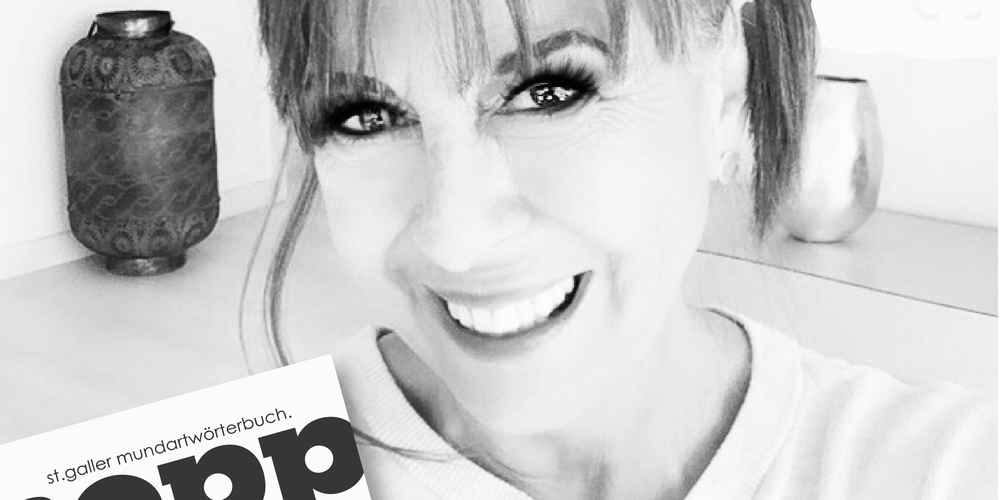«Em Tüüfel en Ohr ab!» ist eine Redensart und bedeutet etwas pausenlos und zu viel machen
In der Mundart findet sich - man will es kaum glauben - reichlich «teuflisches». So zum Beispiel das «Tüüfelszüüg», womit Dinge beschrieben werden sollen, die einem einfach nicht gelingen, oder die ungesund oder gar schädlich für uns sind, wie zum Beispiel alkoholische Getränke, etc. . Diese werden im Hochdeutschen wiederum gern auch als „des Teufels“ bezeichnet. Ist einer ein Nichtsnutz, lebt auf Kosten anderer oder ist gar kriminell, ist er «em Tüüfel ab em Charre gheit»
Meine Grossmutter benutzte zudem gerne den Begriff «Bisch etz doch en cheibe Tüüfelstonder», hatte ich wieder irgendeinen Blödsinn angestellt. Ausserdem wurde einem als Kind gerne gedroht, es würden einem «Tüüfelshörnli» wachsen, wenn man nicht brav sei. Das war ein Argument!
Die Redensart «Em Tüüfel en Ohr ab!» umschreibt indessen den Umstand, dass etwas immer wieder, pausenlos geschieht. So kann zum Beispiel das Telefon läuten «em Tüüfel en Ohr ab!», oder es kommen Mails «em Tüüfel en Ohr ab!»am Laufmeter rein, oder die Kinder fragen einem Löcher in den Bauch «em Tüüfel en Ohr ab!», Auf Hochdeutsch wird diese Redensart nicht wörtlich übersetzt, sondern heisst vielmehr „Bis zum Geht-nicht-mehr“. Der Engländer wäre über solche Masslosigkeit «not amused» und würde sie übersetzen mit: «to do something like crazy»!
Auch bei einem anderen Dialekt-Sprichwort mit ähnlicher Bedeutung, geht es im Kern um den «Leibhaftigen».«Da goht jo of kei Chuehuut», lästern wir öfters, wenn etwas zu viel ist; uns zu viel wird. Will gemäss mittelalterlicher Gepflogenheiten heissen, es passt auf kein noch so grosses Pergament! Denn bevor das Papier im 13. Jahrhundert dank der ersten europäischen Papiermühlen seinen Siegeszug antrat, wurde auf Pergament geschrieben.
Und dieses wurde normalerweise aus Schafs- oder Kalbshäuten hergestellt. Die Menschen aus jener Zeit glaubten nun fest daran, dass der Teufel ihre Sünden stets penibel aufschreibe. War man ein richtiger Bösewicht, dann brauchte der Leibhaftige schon eine Kuhhaut, um alle Schandtaten aufzulisten. Nun war so eine Kuhhaut aber begrenzt und irgendwann passten die zahlreichen Sünden nicht mehr auf eine einzige. Der erste Beleg für die Redewendung sind die «sermones vulgares», von Jaques de Vitry, seines Zeichens Kardinal und Verfasser zahlreicher historischer Schriften, in Reims (F) geboren und in Rom 1240 gestorben. Apropos Rom:
Alljährlich an Weihnachten spricht der Papst den Weltsegen Urbi et orbi und verspricht damit den Ablass aller Sünden. Falls sie mal allzu sehr über die Stränge geschlagen haben.